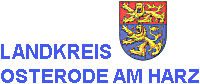Beispiele unterlassener oder missratener Renaturierungen und Methoden der Erkenntnisgewinnung
Gipsabbau und Renaturierung: Entwicklung seit 100 Jahren
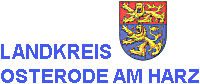
Vortrag von Norbert Südhof,
Landkreis Osterode am Harz
1. Rechtliche Entwicklung Ungeregelter Abbau
Gipsabbau wird seit weit über 100 Jahren im heutigen Kreisgebiet betrieben. Dies geschah, wie bei anderen Rohstoffen auch, zunächst und über lange Zeit ohne Genehmigungen. Eine Ausnahme stellte lediglich der untertägige Abbau nach dem Bergrecht dar, der aber im Gipsabbau die Ausnahme ist.
Wer also früher Gips abbauen wollte, musste sich lediglich um die Verfügbarkeit der betroffenen Grundflächen kümmern und hat im Übrigen nach eigenen Gesichtspunkten abgebaut. War entweder der Bedarf gedeckt oder die Unternehmens- oder Marktsituation nicht mehr entsprechend oder aber die Abbaustätte erschöpft, überließ man diese sich selbst. Bodenabbaugesetz (BoAbG)
Am 1. April 1972 wurde mit dem niedersächsischen „Gesetz zum Schutz der Landschaft beim Abbau von Steinen und Erden (Bodenabbaugesetz)“ erstmals eine Genehmigungspflicht eingeführt.
Erstmals wurde dort im § 1 das „Wirkungsgefüge der Landschaft mit dem Boden, der Tier- und Pflanzenwelt, dem Kleinklima, dem Wasserhaushalt und anderen Landschaftsfaktoren“ beschrieben. Es wurde festgelegt, dass dieses Wirkungsgefüge durch Eingriffe nicht nachhaltig geschädigt werden dürfe. Solche Schädigungen waren definiert durch „die Nutzbarkeit der Landschaft, ihre Eignung für die Erholung oder sonstige in der Landschaft begründete Lebensbedingungen für den Menschen“.
Die Landschaft durfte nicht auf Dauer verunstaltet werden. Landschaftsteile von besonderem Wert sollten erhalten werden. Die abgebaute Fläche musste so hergerichtet werden, dass sie entsprechend der Bauleitplanung und den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wieder genutzt werden konnte.
Dementsprechend wurde eine Verpflichtung zur Herrichtung der Abbaustätten als Teil der Genehmigungsanträge (§5) und der Genehmigungen (§ 6) selbst eingeführt.
Das Bodenabbaugesetz führte zu einer erstmaligen, systematischen Erfassung der tatsächlich vorhandenen Abbaustätten. So wurden im Landkreis im Jahre 1974 in einer Abbaustättenliste u.a. 8 Gipsabbauunternehmen mit 17 Abbaustätten erfasst, von denen 4 unter Bergaufsicht standen.
In der Folge wurden für die bestehenden Abbaustätten erstmals Genehmigungen beantragt. Die Herrichtung wurde im Sinne des geschilderten Grundsatzes geplant. Sie sah i.d.R. die Wiedernutzbarmachung, also „Rekultivierung“ auf der verbliebenen Steinbruchsohle vor. Hierunter wurde meist Wiederaufforstung verstanden.
In dieser Zeit entstand der nicht aus dem Gesetz stammende Begriff des „Rekultivierungsplans“. Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)
Am 1. Juli 1981 trat mit dem NNatG das BoAbG außer Kraft. Besondere Vorschriften über den Bodenabbau waren nun als vierter Abschnitt in den §§ 17 – 23 im NNatG integriert.
Die im NNatG neu geschaffene Eingriffsregelung sah neben dem Vermeidungsgebot Ausgleichsmaßnahmen und, soweit ein nicht ausgleichbarer Eingriff zulässig was, auch Ersatzmaßnahmen vor. Auch der Bodenabbau wurde der Eingriffsregelung unterworfen. Dies war neu, denn bisher brauchten nur Landschaftsteile von besonderem Wert erhalten werden. Das bis dahin geltende Reichsnaturschutzgesetz von 1935 begrenzte diesen besonderen Wert auf seltene oder im Bestand bedrohte Pflanzen- und Tierarten, auf Naturdenkmale und Naturschutzgebiete oder auf „Sonstige Landschaftsteile“ im Sinne der heutigen geschützten Landschaftsbestandteile (§ 28 NNatG) und Landschaften i.S. heutiger Landschaftsschutzgebiete (§ 26 NNatG). Lag kein derartiger Schutz vor, gab es vor Einführung des NNatG auch nichts zu berücksichtigen.
Nun aber mussten und müssen auch heute noch erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes vermieden, ausgeglichen und ggf. ersetzt werden.
Dazu muss zunächst einmal festgestellt werden, ob und ggf. in welchem Umfange denn welche Bestandteile des Naturhaushalts oder ob das Landschaftsbild überhaupt beeinträchtigt werden. Erst wenn das bekannt ist, kann man sagen, welche Beeinträchtigungen ggf. durch entsprechende Abbauführungen vermieden werden können und welche unvermeidbar sind.
Für diese unvermeidbaren Beeinträchtigungen müssen dann Art und Umfang ermittelt werden, um geeignete Maßnahmen zum Ausgleich planen zu können. Geht auch das nicht vollständig, müssen die beeinträchtigten Funktionen und Werte in ähnlicher Weise im vom Eingriff betroffenen Raum ersetzt werden.
Folglich wurden aus den „Rekultivierungsplänen“ „Renaturierungspläne“, weil man richtigerweise versuchte, so viel wie möglich in der Abbaustätte auszugleichen, um möglichst nicht in die Nichtausgleichbarkeit und in teure externe Ersatzmaßnahmen zu kommen. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Genehmigungen zum Gipsabbau erfolgen seit Mitte der 80er Jahre i.d.R. nach dem Bundes-immissionsschutzgesetz (1974), da der Abbau kaum ohne Sprengungen möglich ist. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung konzentriert alle anderen Genehmigungen in sich, also auch die naturschutzrechtliche.
An der Eingriffsregelung änderte sich dadurch jedoch nichts. Bundesberggesetz (BBergG)
Im Kreisgebiet stehen derzeit noch zwei Abbaustätten unter Bergrecht (ehem., auf das Allgemeine Berggesetz von 1865 zurückgehende Landesbergrecht, dann Bundesberggesetz v. 1982), weil dort aus Kriegsjahren noch alte Stollen vorhanden sind, aus denen gelegentlich Anhydrit gewonnen wird.
Auch hier kommt die Eingriffsregelung zum Tragen.
2. Erkenntnisgewinnung bei Renaturierungen Die Anfangsphase
Für die Abbaufirmen war die Eingriffsregelung zunächst nur etwas, das die Abbaukosten in die Höhe trieb. Außerdem wollte man ja lediglich und wie schon immer Gips abbauen, verarbeiten und vor allem verkaufen.
Es brauchte schon eine gewisse Zeit der Erkenntnisreifung, dass es sich hier um eine gesetzliche Forderung und nicht um die „Spinnereien“ einiger „Öko-Fuzzies“ handelte.
Auch waren viele Planer mit der Eingriffsregelung hoffnungslos überfordert. Sie haben die Inhalte der Eingriffsregelung gar nicht verstanden. Häufig waren die vorgesehenen Maßnahmen aus rein gärtnerischem Verständnis heraus geplant und umgesetzt und hatten nichts mit den natürlichen Gegebenheiten im Gipskarst und erst recht nichts mit Kompensation der beeinträchtigten Funktionen und Werte zu tun.
Es hat weit über 10 Jahre gedauert, bis dass hinreichend brauchbare Verfahren entwickelt waren, um den hohen gesetzlichen Ansprüchen hinsichtlich Ausgleich und funktionalem Ersatz wenigstens annähernd zu genügen.
Dabei hat es in der Übergangsphase manche „Stilblüten“ gegeben, und zwar auf allen Seiten, sowohl von den Abbauunternehmen, als auch von den Fachplanern und den Naturschutzbehörden. In dieser Zeit wurde so mancher Kampf ausgetragen, auch vor Gerichten. Und so manche Energie hätte aus heutiger Sicht sinnvoller in bessere Renaturierung gesteckt werden können.
Beispiele: - Bereits die Aufforstungen der „Rekultivierungsphase“ zeigten vielfach, dass man häufig von der irrtümlichen Annahme ausging, man könne auf frisch eingebauten Abraum, der mit mehr oder weniger Oberboden abgedeckt wurde, direkt Zielwaldtypen pflanzen. Da man es im Hinblick auf die Ausgleichswirkung schnell erreichen, gleichzeitig aber auch einen geringen Pflegeaufwand haben wollte, wurde häufig viel zu dicht gepflanzt.
Die Ergebnisse sahen oft schon nach einem Jahr aufgrund der Trockenheit relativ traurig aus. Auf geschüttetem Boden gibt es nämlich kein funktionierendes Kapillarsystem. Dies muss sich erst im Verlauf mehrerer Jahre bilden. Und der zunächst abgeschobene und dann meist lange Zeit zwischengelagerte Oberboden ist nach Aufbringung eben kein gewachsener Waldboden mehr.
Folglich musste häufig teuer nachgepflanzt werden und die Artenzusammensetzung hat sich im Laufe der Jahre in der jeweiligen Fläche dennoch durch natürliche Auslese erheblich verändert. - So mancher geplante und dann teuer hergerichtete und vermeintlich abgedichtete „Feuchtbiotop“ hat im Gipskarst noch nie oder nicht länger als drei Tage Wasser geführt.
- Mit „landschaftsgerechter Neugestaltung des Landschaftsbildes“, wie sie im § 10 NNatG ausdrücklich als Ausgleichsmaßnahme aufgeführt ist, hat so manche einplanierte Abraumhalde nun wirklich nichts zu tun.
Lernen aus der Natur und aus Misserfolgen
Man könnte nun annehmen, dass es grundsätzlich besser sei, gar nichts zu tun, denn es gibt immerhin einige Beispiele offengelassener kleiner Gipssteinbrüche, die heute eine Fülle seltener Arten aufweisen und selbst bereits Teile von Schutzgebieten geworden sind.
Dies widerspräche jedoch dem gesetzlichen Auftrag, denn der Verursacher eines Eingriffs hat die betroffenen Grundflächen so herzurichten, dass keine erhebliche Beeinträchtigung zurückbleibt.
Vor allem aber kann man angesichts der heutigen Dimensionen industriell betriebener Steinbrüche nicht mehr davon ausgehen, dass diese sich wie die alten, handbetriebenen Kleinsteinbrüche quasi von selbst entwickeln.
Denn zum einen sind die Flächen, aus denen heraus sich die entsprechenden Pflanzen- und Tierarten in die Steinbrüche hinein entwickeln könnten, selbst rar geworden. Außerdem wären die Entfernungen zwischen verbliebenem Restlebensraum im Umfeld und den wenigen geeigneten Flächen innerhalb der nicht hergerichteten Industrie-Steinbrüche mit ihren großen, glatten Fahr- und Abbausohlen für viele Arten inzwischen viel zu groß.
Folglich wären die Aufrechterhaltung wesentlicher Lebensfunktionen der betroffenen Pflanzen- und Tierarten sowie die Erhaltung oder landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes weder zeitnah, noch in absehbarer Zeit gewährleistet.
Damit wäre der gesetzlich geforderte Ausgleich und ggf. Ersatz, wie er auch in den NNatG-Kommentaren von Blum/Agena/Franke 1 oder Louis 2 dargestellt ist, nicht erbracht.
Also sind intelligente Lösungen bereits bei der Abbauplanung und Durchführung genau so nötig, wie der Mut zu neuen Verfahren und die Bereitschaft, solche Verfahren durch Monitoring zu begleiten, damit auch andere von den Erkenntnissen profitieren können, insbesondere aber die Natur selbst.
Beispiele:
- Zurückhaltung bei Aufforstungen. Und wenn schon, dann nicht sofort mit Schlussgesellschaften.
- Frühzeitiges Auflichten künftiger Waldränder beim Abbau in bestehende Waldflächen hinein, um durch frühzeitige Waldrandbestockung das Waldbinnenklima im verbleibenden Wald zu erhalten.
- Herrichten von Mosaiken verschiedener Bereiche, auch solcher mit Rohböden, um der natürlichen Sukzession und ihren Tier- und Pflanzenarten Raum und Zeit zu geben.
- Umsiedeln von besonderen Vegetationsbeständen auf vorbereitete Flächen ähnlicher Rahmenbedingungen, um bestimmte Arten zu erhalten und Keimzellen bekannten Arteninventars zu schaffen.
- Einbringen von Schnittgut entsprechend ausgewählter Ausgangsbiotope auf vorbereitete Flächen, um autochtones Saatgut dort einzubringen.
- Schaffen von Reliefformen des Gipskarstes, um ein entsprechendes Landschaftsbild, aber auch kleinräumige Mikroklimate zu erzeugen, beispielsweise
- Erdfälle,
- Karsttälchen,
- Steilwände.
Diese müssen sich möglichst weit aus der jeweiligen näheren Umgebung ableiten, um so mittel- bis langfristig den Charakter einer scheinbaren Natürlichkeit zu gewinnen. Das ist landschaftsgerechte Neugestaltung.
Insgesamt muss also Raum und Möglichkeit für eine weitgehend natürliche Entwicklung auf landschaftsgerecht gestaltetem Relief mit möglichst viel naturnahen Boden- und Standortbedingungen geschaffen werden.
3. Ausblick Das BNatSchG wurde 2002 grundlegend geändert, hier insbesondere die Eingriffsregelung betreffend. Die Länder müssen das neue Rahmenrecht bis 2005 in Landesrecht umsetzen. Was in Niedersachsen dabei herauskommen wird, ist noch unklar. Bisher sind lediglich Teile übernommen worden.
Sicher wird es aber bei der Notwendigkeit zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen bleiben.
Die beschriebenen Erkenntnisse und Entwicklungen werden also auch für die Zukunft ihre grundsätzliche Richtigkeit nicht verlieren. Sie stellen aber genau so sicher noch lange nicht die absolute Weisheit schlechthin dar.
Die Erkenntnisse werden weiter gehen und künftige Renaturierungen besser werden lassen. Das kann sehr wohl auch kostengünstigere, aber noch wirkungsvollere Methoden beinhalten.
1 BLUM / AGENA / FRANKE: Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) Kommentar Stand 08/04, Wiesbaden 1990
2 LOUIS: Niedersächsisches Naturschutzgesetz Kommentar, Bd.1 §§ 1 – 34, Braunschweig 1990
|